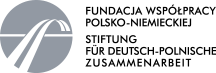Martin Pollack: Meine Begegnungen mit Belarus
Der Schriftsteller und Übersetzer Martin Pollack ist seit 2011 Kurator von „tranzyt. Literatur aus Polen, der Ukraine und Belarus“, des neuen Programmschwerpunktes auf der Leipziger Buchmesse, die am Donnerstag beginnt. Im folgenden Text "Meine Begegnungen mit Belarus" berichtet er sehr persönlich über Polen und Belarus.
An meine ersten Begegnungen mit Belarus, mit weißrussischen Autoren, Übersetzern und Kulturschaffenden, habe ich nur undeutliche Erinnerungen, die ich zeitlich schwer festmachen kann. Ich nehme an, dass diese Begegnungen in Polen stattfanden, Mitte der sechziger Jahre, als ich dort zu studieren begann. In den ersten Jahren meines Studiums an der Slawistik in Wien haben wir sicher auch etwas über die weißrussische Literatur gehört, aber ich glaube nicht, dass sie Gegenstand einer eigenen Vorlesung war. Gab es einen Kurs für Weißrussisch? Ich weiß es nicht mehr, ich habe ihn jedenfalls nicht besucht.
Die Belarussische Sozialistische Sowjetrepublik, kurz BSSR, die bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991 existierte, aber vor allem die belarussische Literatur waren selbst für Spezialisten Randgebiete, mit denen sich nur wenige eingehender beschäftigten – ein Umstand, der bis heute nachwirkt.
In Polen war das naturgemäß anders. Die beiden Länder sind Nachbarn und durch die Geschichte eng miteinander verbunden – aber es gibt auch vieles, was sie trennt. Es existieren zahlreiche Konflikte, die ihre Wurzeln in der gemeinsamen Geschichte haben, in der Polen gewöhnlich die Oberhand hatte. Das hat man in Belarus bis heute nicht vergessen. In diesem Zusammenhang denke ich oft an den Vater eines englischen Freundes, mit dem ich in Warschau ein Zimmer im Studentenheim teilte. Sein Vater war mit der polnischen Armee von General Anders nach England gekommen, als polnischer Soldat, in polnischer Uniform, aber er hasste die Polen. Er war Weißrusse und stammte aus der Gegend von Pinsk, das vor dem Krieg zu Polen gehört hatte. Ich brauchte lange, bis ich mich halbwegs in diesen Wirrungen der polnisch-belarussischen Geschichte zurechtfand.
Als ich 1967 auf die seltsame Idee kam, über Weihnachten nicht nach Hause zu fahren, sondern die Feiertage in einer polnischen Kleinstadt zu verbringen, in der ich keine Seele kannte, wählte ich aus einem für mich heute nicht mehr nachvollziehbaren Grund Augustów, eine kleine, damals wie heute unbedeutende Stadt nahe der weißrussischen Grenze.
In Augustów begegnete ich den ersten Weißrussen, vier oder fünf junge Burschen, ungefähr in meinem Alter, die ich in einem Lokal traf, ich glaube es war das einzige Restaurant, das in Augustów über die Feiertage offen hatte. Eine trübe, verrauchte Bude, in der es nicht viel mehr gab als Wodka, śledź po japońsku (marinierter Hering auf japanische Art, wobei ich nie erfahren habe, was die Speise mit Japan zu tun hat) und Wurst mit gebratenem Zwiebel (beides kalt), die, ihrem Aussehen nach zu schließen, in der Vitrine bei der Schank nicht ihr erstes Weihnachtsfest erlebte. Wir hielten uns an den Wodka. Nach der dritten oder vierten Flasche begannen meine neuen Freunde über die Situation der weißrussischen Minderheit in Polen zu erzählen, über vielfältige Diskriminierungen und Ausgrenzungen. Wer sich offen als Weißrusse bekenne, so sagte ihr Wortführer im Flüsterton, wobei er wachsame Blicke in die Runde warf, obwohl wir die einzigen Gäste waren, werde von den Behörden schikaniert, überhaupt werde die weißrussische Kultur auf Schritt und Tritt unterdrückt. Die anderen nickten und schauten trüb in ihre Gläser. Ich fand das ungeheuer spannend.
Etwa zwanzig Jahre später – die Situation der Minderheit hatte sich in Polen deutlich verbessert, es gab belarussische Zeitungen und Zeitschriften, die diesen Namen verdienten, Verlage, Festivals und anderes mehr – lernte ich in Warschau den Doyen der belarussischen Literatur in Polen, Sakrat Janovič, kennen. Ein polternder, breitschultriger Mann mit offenem, bäuerlichem Gesicht, ein Meister der kurzen Prosa, kleiner poetischer Skizzen und kurzer Erzählungen, die häufig in seiner mała ojczyzna, seiner „kleinen Heimat“, der Region von Białystok, spielen. Dort hat Janovič in seinem Heimatdorf Krynki ein Zentrum der belarussischen Kultur errichtet, bescheiden Villa Sokrates genannt, zusammen mit dem Maler Leon Tarasewicz, der ebenfalls stolz seine weißrussische Herkunft betont. Seit über zehn Jahren erscheint in Krynki der „Annus Albaruthenicus“, ein Jahrbuch mit Aufsätzen, Prosastücken, Gedichten und Rezensionen, das eine hervorragende Übersicht über das Schaffen belarussischer Autoren und Intellektueller bietet. Überhaupt hat sich Polen seit Jahren als wichtiger Drehpunkt und Vermittler für die belarussische Literatur etabliert – in polnischen Zeitschriften und Verlagen erscheinen zahlreiche Übersetzungen der neuesten belarussischen Werke, und die polnische Presse informiert umfassend über die Vorgänge jenseits der Grenze, worauf die belarussischen Behörden gern auf ihre Art antworten. Der Korrespondent der überregionalen „Gazeta Wyborcza“ zum Beispiel, Andrzej Poczobut, belarussisch: Andrej Pačobut, aus der im Länderdreieck Belarus, Litauen und Polen gelegenen belarussischen Provinzstadt Grodno, wurde im März 2011 wegen seiner kritischen Berichterstattung verhaftet und zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe – mit Bewährung auf zwei Jahre – verurteilt. Doch Poczobut lässt sich nicht einschüchtern und berichtet weiter aus seiner Heimat.
Seit der Begegnung mit Janovič nahm ich jede sich mir bietende Gelegenheit wahr, um belarussische Autoren zu treffen – in Warschau, in Krakau, in Danzig, in Sejny, in Lemberg, in Berlin, in Leipzig, wobei ich es allerdings nie schaffte, die Sprache zu erlernen, was ich mir bis heute vorwerfe. An Begegnungen in Österreich kann ich mich nicht erinnern, hierzulande scheint Belarus noch viel weiter weg zu sein als etwa in Deutschland. Dass „Literatur und Kritik“ mir oder besser uns: Thomas Weiler und mir, Gelegenheit gibt, dieses Dossier zu präsentieren (ohne Tomas Weiler wäre es nie zustande gekommen!), kann ich gar nicht genug rühmen.
Ich glaube es war in Leipzig, wo ich Valžyna Mort kennen lernte, diese junge, hübsche, zarte Lyrikerin mit der unglaublich starken, originellen, überzeugenden Stimme, ohne Zweifel eines der größten Talente der gegenwärtigen belarussischen Literatur. Ihr Gedichtband „Tränenfabrik“, erschienen 2009 bei Suhrkamp, fand im deutschsprachigen Raum ein begeistertes Echo. Inzwischen lebt Valžyna in den USA und schreibt, zumindest teilweise, englisch. Bei unserer ersten Begegnung kritisierte die junge Lyrikerin die Attitüde mancher westlicher Kritiker, alles, was belarussische Autoren, sogar Lyriker, schrieben, primär auf politische Inhalte hin abzusuchen, auf eine Kritik am System Lukaschenka. Das bezeichnete Valžyna als großes Missverständnis – und als ungerecht den Autoren gegenüber. Es sei unannehmbar, dass sie ungefragt in die Rolle von politischen Kommentatoren, von Ideologen gedrängt würden. „Wer unsere Texte ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt liest, der lässt sich vieles entgehen“, sagte sie mit traurigem Lächeln.
Damals lernte ich auch die Lyrikerin Volha Hapiejeva kennen – und Andrej Chadanovič, auch er vor allem als Lyriker bekannt, als Performancekünstler, aber auch als Essayist und Übersetzer. Es hat mit der speziellen Situation der belarussischen Literatur, ihrer politisch bedingten Isoliertheit zu tun, dass die meisten belarussischen Autoren auch Übersetzer sind. Andrej traf ich später immer wieder, in Polen, in Deutschland, in Belarus. Erst vor kurzem las ich in der „Gazeta Wyborcza“ – eine der wichtigsten Quellen, um mich über die Situation in Belarus, über die Repressionen, aber auch über die Literaturszene, Neuerscheinungen und Diskussionen, zu informieren – ein kluges Interview, in dem er seine Kollegen dazu auffordert, der bedrückenden politischen Situation mit Ironie zu begegnen. „Lachen hilft zu überleben“, sagt Andrej dort. Seinen Bekannten, die verständlicherweise Angst vor Repressionen hätten, sage er oft: wenn sie jemanden fürchteten, sollten sie sich ihn lächerlich vorstellen, so wie Harry Potter seinen Zauberspruch riddikulus verwende. „Dann wird auch aus Lukaschenka ein gewöhnlicher Clown, der er schließlich auch ist, und kein schrecklicher Voldemort.“
Die Weißrussen behaupten von sich selber gern, sie neigten nicht zu revolutionärem Überschwang, sondern seien eher in sich gekehrt und melancholisch. Mag sein, aber ich habe viele von ihnen als sehr humorvoll erlebt, Valžyna Mort zum Beispiel, auch Andrej Chadanovič, der den Humor sogar als politische Waffe empfiehlt, oder den Autor, Künstler und Verleger Zmicier Višnioŭ, einer der führenden Gestalten der jungen unabhängigen Literatur in Belarus. Zmicier traf ich nach einer Lesung in Minsk, zu der mich das dortige Goethe-Institut eingeladen hatte. Er kam auf mich zu wie ein Wirbelwind, überschüttete mich mit einem Wortschwall in mehreren Sprachen gleichzeitig, deutsch, englisch, belarussisch, polnisch, wobei er scheinbar mühelos von einer Sprache zur anderen hüpfte, dazwischen lachte er viel, gestikulierte wild und drängte mir ein Glas Wein nach dem anderen auf. Mir schwirrte bald der Kopf ob der sprachlichen und thematischen Sprünge und Haken, aber ich fand ihn unterhaltsam und klug – und witzig. In Leipzig soll heuer das erste Buch Višnioŭs in deutscher Übersetzung erscheinen, „Das Brennesselhaus“. Es ist zu hoffen, dass es die gebührende Beachtung findet.
Das ist der belarussischen Literatur insgesamt zu wünschen. Endlich. Es wäre wirklich an der Zeit. Das folgende Dossier kann natürlich nur einen kleinen, subjektiven Ausschnitt bieten, ein paar Beispiele, Fragmente, die hoffentlich imstande sind, Neugierde zu wecken und die Lust auf mehr.
Copyright Martin Pollack
mit freundlicher Genehmigung des Autors.
„tranzyt“ ist ein Projekt der Leipziger Buchmesse, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der Rinat Ahmetov Stiftung „Rozvytok Ukrajiny“, der Allianz Kulturstiftung, dem Lemberger Verlegerforum und dem Polnischen Institut in Leipzig. Kurator des Projektes ist der Autor, Übersetzer und Träger des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2011 Martin Pollack.