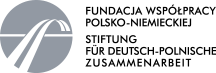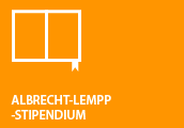Gemeinschaft für schwierige Zeiten
Gemeinschaft für schwierige Zeiten: Chancen für einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland
Sebastian Płóciennik, Cornelius Ochmann: Direktoren der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)
Vor über drei Jahrzehnten standen Polen und Deutschland vor der Chance, aus dem Schatten ihrer tragischen Vergangenheit herauszutreten, gutnachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen und ein gemeinsames strategisches Ziel zu verwirklichen: die Ausweitung der westlichen Strukturen nach Osten. Auf dem VI. Deutsch-Polnischen Forum im Februar 1990 sprach der damalige polnische Außenminister Krzysztof Skubiszewski in diesem Zusammenhang von einer „Interessen-Gemeinschaft“.
Der Beitritt Polens zur Europäischen Union im Jahr 2004 war die Krönung – und gewissermaßen das Ende – dieser „Gemeinschaft“. An die Stelle gemeinsamer Strategien traten Meinungsverschiedenheiten über den Irakkrieg, die deutschen Beziehungen zu Russland und im Alltagsgeschäft europäischer Streitfragen, etwa um die sprichwörtlichen Milchquoten. In den öffentlichen Diskurs kehrten schwierige historische Themen zurück, insbesondere über den Umgang mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges, begleitet von negativen Stereotypen. Rund ein Jahrzehnt nach der historischen EU-Erweiterung wuchsen auf polnischer Seite das Misstrauen, auf deutscher Seite die Gleichgültigkeit.
Neuer Aufbruch
Es gibt heute Chancen auf eine neue Dynamik in den bilateralen Beziehungen – vor allem wegen gemeinsamer Interessen. Deutschland und Polen sehen sich heute äußeren Bedrohungen für Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt gegenüber. Diese „schwierigen Zeiten“ betreffen Kowalski und Schmidt gleichermaßen – ein Anreiz, gemeinsam nach Antworten zu suchen und sie idealerweise auch gemeinsam zu formulieren.
Heute ist das ein wenig einfacher als noch vor einem Jahrzehnt. Obwohl die politischen Unterschiede nach wie vor deutlich sind, haben sich beide Gesellschaften einander angenähert, Entwicklungsasymmetrien sind verblasst, und auch die gegenseitigen Erwartungen sind realistischer geworden. Gemeinsame Initiativen Polens und Deutschlands werden zudem von Nachbarn und Verbündeten erwartet. Europa ist auf neue Impulse zu seiner Stärkung angewiesen, und nichts spricht dagegen, dass sie aus dem deutsch-polnischen Dialog oder aus den Formaten Weimarer Dreieck und Weimar+ hervorgehen.
Erstens: Sicherheit
Priorität hat heute die Sicherheit Europas. Die russische Aggression, der weltpolitische Machtanspruch Chinas und der zunehmend interessengeleitete Kurs der USA trafen auf ein strategisch „schlummerndes“ Europa. Polen erkannte die östliche Bedrohung früher und gibt heute über 4 % des BIP für Verteidigung aus. Deutschland holt auf, kündigt sogar eine Billion Euro für Verteidigung und Infrastruktur an und plant groß angelegte Investitionen in die Rüstungsindustrie. Die deutsche Gesellschaft beginnt zu begreifen, wie wichtig eine starke Armee ist und welche Rolle ein „verteidigungsfähiges“ Deutschland für die Sicherheit Europas spielt. Dieser neue Ansatz sollte auch davon ausgehen, dass es keine Rückkehr zu den früheren Beziehungen mit Putins Russland geben kann.
Eine vordringliche Aufgabe für Warschau und Berlin ist es, die Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen, denn „die Verteidigung Europas beginnt am Dnipro“, wie man in beiden Hauptstädten hört. Im Interesse Polens und Deutschlands liegt auch die Aufrechterhaltung einer starken US-Präsenz in Europa, was jedoch höhere Rüstungsausgaben und mehr Eigenverantwortung des Kontinents erfordert. Das gelingt nicht ohne eine Reform der EU-Fiskalregeln, die mehr Spielraum für nationale Verteidigungsausgaben bieten, ohne einen Kompromiss über Verteidigungsanleihen und ohne eine Ausweitung gemeinsamer EU-Investitionen. Ebenso zentral sind die Koordinierung der Rüstungs- und Munitionsproduktion, die Angleichung von Standards und die Entwicklung militärischer Schlüsseltechnologien. Ein Leuchtturmprojekt – mit wesentlicher deutsch-polnischer Komponente – könnte der Aufbau eines Drohnen-Abwehrschirms entlang der Ostflanke der NATO sein.
Sicherheitspolitik muss jedoch breiter gefasst werden. Notwendig sind Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, die schnelle Truppenverlegungen und reibungslosen Militärtransport ermöglicht. Im Interesse beider Länder liegt auch der Kampf gegen illegale Migration, die als hybride Waffe gegen Europa eingesetzt wird – kein hypothetisches Szenario, sondern eine Herausforderung, die bereits heute hohe Kosten in beiden Ländern verursacht.
Eine starke Wirtschaft
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit bildet traditionell ein solides Fundament der bilateralen Beziehungen: 2024 überstieg das Handelsvolumen 170 Mrd. Euro. Der polnische Markt ist für den deutschen Export inzwischen wichtiger als der chinesische – nicht nur wegen der angestrebten „Risikodiversifizierung“ gegenüber dem Reich der Mitte, sondern auch dank des dynamischen Wachstums der polnischen Wirtschaft. Polen ist heute wohlhabender und technologisch besser aufgestellt, um Spielraum für die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung sowie bei großen gemeinsamen Infrastrukturprojekten - etwa zur Anbindung der Ukraine an die EU - anzubieten.
Dennoch mangelt es nicht an Herausforderungen für „schwierige Zeiten“. Besonders hart treffen sie Deutschland, das mehrere Jahre der Stagnation und eine tiefgreifende strukturelle Krise hinter sich hat. Viele der Probleme – demografischer Wandel, hohe Energiekosten oder der wachsende globale Protektionismus – betreffen auch Polen und sollten Anstoß für eine gemeinsame Antwort geben, idealerweise auf europäischer Ebene.
Priorität beider Regierungen sollte die Vollendung des Binnenmarkts sein. In der scheinbar offenen Wirtschaftszone der EU bestehen weiterhin Barrieren, die allein im Industriebereich einem Zollniveau von über 40 % gleichkommen. Ihre Beseitigung würde globale Handelskonflikte entschärfen und der EU einen kräftigen Entwicklungsschub geben. Darüber hinaus bedarf der Binnenmarkt einer Erweiterung, etwa durch die überfällige Kapitalmarktunion, die die Kreditkosten senken würde – eine gute Nachricht für polnische und deutsche Start-ups, die bislang oft auf Kapitalquellen außerhalb Europas angewiesen sind.
Polen und Deutschland sollten zudem die Grundlagen einer neuen Industriepolitik mitgestalten – pragmatischer in Fragen der grünen Transformation, der Energieversorgung und der Regulierungsdichte sowie innovationsorientiert, insbesondere bei der Digitalisierung. Neue Investitionen sind dafür unerlässlich, doch eine rein nationale Finanzierung birgt das Risiko von Wettbewerbsverzerrung zugunsten wohlhabenderer Staaten. Besser wäre es, die EU würde Ländern, die fiskalische Disziplin wahren und ambitionierte Reformen umsetzen, Mittel aus Fonds zur Verfügung stellen.
Die Europäische Union: Auf dem Weg zur Erweiterung und institutionellen Reformen
Berlin und Warschau haben auch hinsichtlich der Zukunft der EU vieles miteinander zu klären. In einer Welt wachsender Spannungen und Konfrontationen, Handelskriege und transaktionaler Politik wird die EU für die Europäer zum zentralen Instrument, um ihre Interessen auf globaler Ebene zu wahren und durchzusetzen. Umso mehr gilt es, ihre Handlungsfähigkeit zu stärken.
Die Konfrontation ideologisch aufgeladener Positionen – etwa zwischen den „Vereinigten Staaten von Europa“ versus dem „Europa der Vaterländer“ – erweisen sich in den deutsch-polnischen Debatten als wenig fruchtbar. Ein ausgewogenes Verhältnis lässt sich finden, indem man sich gemeinsam konkreten Herausforderungen stellt, etwa der EU-Erweiterung um die Ukraine und die Westbalkan-Staaten.
Im strategischen Interesse Polens und Deutschlands liegt der Beitritt neuer Mitglieder. Aus Berliner Perspektive setzt ein erfolgreicher Erweiterungsprozess jedoch institutionelle Reformen voraus, insbesondere eine Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen im Rat, um die Entscheidungsfindung effizienter zu gestalten. Aus polnischer Perspektive wiederum sind Mechanismen unerlässlich, die eine mögliche Dominanz der größten Mitgliedstaaten verhindern. Die Palette möglicher Kompromisse ist dabei breit genug, um auch Raum für einen gemeinsamen deutsch-polnischen Reformvorschlag zu bieten.
Ein weiterer Bereich deutsch-polnischer Zusammenarbeit sollte die Vertiefung der Beziehungen zu Staaten außerhalb der EU sein, die ihr jedoch eng verbunden sind: vor allem zu Großbritannien, Norwegen und der Türkei, die in der Sicherheits-, Energie- und Wirtschaftspolitik wichtige Partner darstellen. Mögliche Wege zur Intensivierung dieser Beziehungen sollten idealerweise im Rahmen ernsthafter Gespräche im Weimarer Dreieck Format gesucht werden.
Gesellschaften unter Veränderungsdruck
Die zeitgenössische deutsch-polnische Diskussion darf sich nicht auf große geopolitische und wirtschaftliche Fragen beschränken. Erforderlich ist auch eine gemeinsame Reflexion über den tiefgreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Wandel, den wir erleben, insbesondere den Einfluss neuer digitaler Technologien auf unser Leben.
Unter besonderem Druck steht die Medienwelt, die für die öffentliche Debatte, Meinungsbildung und politische Entscheidungen eine zentrale Rolle spielt. In ihr haben soziale Plattformen Einzug gehalten, die anfällig sind für Desinformation, Polarisierung und externe Manipulation. Problematisch ist die dort praktizierte Übernahme journalistischer Inhalte ohne angemessene finanzielle Vergütung, was traditionelle Medien zusätzlich schwächt – ein Trend, der sich mit dem Vormarsch künstlicher Intelligenz noch verstärken wird. Der Schutz seriösen Journalismus und der Kampf gegen Desinformation sollten sowohl auf die Agenda beider Regierungen als auch auf gemeinsame Foren von Medienschaffenden aus Polen und Deutschland – etwa den von der Stiftung veranstalteten Medientage - rücken.
Die Debatte über den Wandel von Lebensrealitäten muss auch die kulturelle Sphäre einbeziehen. Von der Politik oft unterschätzt, bietet Kultur einen universellen Raum der Verständigung, in dem Emotionen, Eindrücke und Erfahrungen vermittelt werden können – eine wirksame Soft Power. Das wertschätzende Interesse des Nachbarn an der eigenen Kunst und dem kulturellen Erbe bringen mehr positive Effekte als manch politische Erklärung.
Erfreulich ist, dass sich Polen und Deutschland in kultureller Hinsicht in den vergangenen Jahrzehnten angenähert haben, was vor allem dem Engagement ihrer Gesellschaften zu verdanken ist. Ausdruck dessen sind etwa mehr als 100 gemeinsame Kulturprojekte pro Jahr, die von der SdpZ gefördert werden. Hinzu kommen die enge Kooperation von Kultureinrichtungen, zahlreiche Veranstaltungen mit Gastauftritten aus dem Nachbarland, Künstleraustausche in Residenzprogrammen sowie die Aktivitäten des Polnischen Institutes und des Goethe-Institutes.
Viele Entwicklungen stimmen jedoch nicht optimistisch. Besorgniserregend ist der Rückgang literarischer Übersetzungen sowie sinkende Auflagen belletristischer Werke – eine gesamteuropäische Tendenz, was keine Ausrede sein darf. Auch das Interesse junger Menschen am Nachbarland, seiner Kultur und Sprache nimmt ab. Ohne gezielte Maßnahmen – z.B. durch einen Ausbau der Förderkapazitäten des Deutsch-Polnischen Jugendwerks – ist eine Korrektur dieser Entwicklung nicht zu erwarten. Ein Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen setzt gezielte Förderung voraus – unter anderem für Literaturübersetzungen und die Ausbildung entsprechender Fachkräfte, für Verlage, die sich gemeinsamen Themen widmen (etwa der Zeitschrift „Dialog“) und nicht zuletzt für eine stärkere Präsenz der Nachbarliteratur in den Lehrplänen sowie den systematischen Ausbau des Sprachunterrichts in Polnisch und Deutsch.
Das grenznahe Geflecht der Zusammenarbeit
So wichtig die globale Politik auch ist - die direkten bilateralen Beziehungen dürfen nicht vernachlässigt werden. Ein großer Erfolg ist dabei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die in den letzten Jahrzehnten durch immer engere Verflechtungen von Kommunen und zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgebaut wurde. Ihre Früchte zeigen sich in der lokalen Wirtschaft, im Bildungsbereich, im Umweltschutz, im Verkehrswesen sowie in der Sozialfürsorge. Auch das Bild vom jeweiligen Nachbarn hat sich verbessert, wie die jährlichen Umfragen des Deutsch-Polnischen Barometers belegen.
Dieses über Jahre gewachsene, gleichwohl fragile und ausbaufähige Netzwerk wirkt stabilisierend auf die deutsch-polnischen Beziehungen, was sich besonders bemerkbar machte, wenn die Hauptstädte um „große“ Themen stritten. An der Grenze zählten hingegen persönliche Kontakte, gegenseitiges Vertrauen und die Bereitschaft, gemeinsam pragmatische Lösungen für konkrete Probleme zu finden.
Umso beunruhigender ist, dass diese Regionen heute die hohe Kosten im Kampf gegen illegale Migration tragen müssen. Die von der Bundesregierung eingeführten Grenzkontrollen treffen den Kern der grenzüberschreitenden Gemeinschaft – den freien Personenverkehr. Die sicherheitspolitischen Gründe für diese Maßnahmen und die damit verbundenen gesellschaftlichen Erwartungen sind nachvollziehbar, doch die finanziellen, politischen und sozialen Kosten sind erheblich. Es bedarf eines tragfähigen Kompromisses, der einerseits den wirksamen Schutz der östlichen EU-Grenze gewährt und andererseits klare Bedingungen und einen Zeitplan für die Aufhebung der Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze definiert.
Geschichte in guten wie in schlechten Zeiten
Ungeachtet aktueller Herausforderungen bleibt die gemeinsame Geschichte ein wichtiger Bezugspunkt. Der Verlauf historischer Debatten beeinflusste oft das Klima der Zusammenarbeit – von Enthusiasmus über Gleichgültigkeit und Misstrauen bis zur Suche nach neuen Schnittstellen.
Eine große Herausforderung in den bilateralen Beziehungen ist das Gefühl vieler Polinnen und Polen, dass die verbrecherische Politik des Dritten Reichs gegenüber dem östlichen Nachbarn im deutschen Geschichtsbewusstsein nicht den ihr gebührenden Platz einnimmt – und dass eine angemessene Wiedergutmachung bis heute aussteht. Daraus resultiert die relativ breite Unterstützung für Reparationsforderungen, die auf die legalistische Position Deutschlands treffen, wonach die Frage rechtlich endgültig abgeschlossen sei.
Diese Konstellation schafft eine schwer zu überwindende Blockade, die politisch überwunden werden muss. Die Unterstützung der noch lebenden Kriegsopfer bleibt ein offenes Thema und verdient eine ernsthafte Initiative der Bundesregierung. Die Entscheidungen zum Bau eines Denkmals für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung in Berlin und eines Deutsch-Polnischen Hauses gehen in die richtige Richtung. Ein weiterer Schritt wäre, Polen und seinen Kriegserfahrungen mehr Aufmerksamkeit in deutschen Lehrplänen zu widmen. Diese Maßnahmen sind nicht als „Entschädigungen“, sondern als Reaktion auf das erwähnte Gefühl der Ungerechtigkeit zu verstehen.
Für die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen wird es entscheidend sein, Lehren aus der Vergangenheit mit Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu verknüpfen. Die beste Gelegenheit hierfür ist die gemeinsame Verteidigung Europas. Deutschland hat die Chance, eine historisch wichtige Rolle zu spielen: Ein materielles, finanzielles und politisches Engagement der Bundesrepublik für die Verteidigung der NATO-Ostflanke, eng mit Polen abgestimmt, wäre eine angemessene Schlussfolgerung aus der schwierigen Vergangenheit und ein wichtiger Schritt hin zu einer neuen „Gemeinschaft für schwierige Zeiten“.
Warschau, 19. Mai 2025
Der Text dient als Diskussionsvorlage für das Deutsch-Polnische Forum 2025 (4./5. Juni 2025 in Berlin).