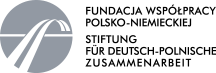Kampf um die Rechte des Arbeitnehmers – ein Bericht von Mariusz Bartodziej
Wie ist aus dem 16-Stundentag der 8-Stundentag geworden? Wie sind Kranken- und Rentenversicherungen für Angestellte entstanden? Wie kam es dazu, dass Kinder unterrichtet werden, statt gute zehn Stunden in einer Fabrik zu schuften? Diese Fragen beantwortet die Ausstellung „In die Zukunft gedacht – Bilder und Dokumente der deutschen Sozialgeschichte“, die bis zum 29. September im Collegium Polonicum in Słubice zu sehen ist.
Die Ausstellung beschreibt nicht nur den sozialen Weg, den Deutschland gegangen ist, sondern stellt auch wichtige Fragen zur Zukunft. Bedeutet die Übernahme von „Drecksarbeit“ durch Maschinen für uns eine Befreiung oder ist sie auf lange Sicht eine Bedrohung? Wo verläuft in Fragen Gesundheit die Grenze zwischen individueller und gesellschaftlicher Verantwortung? Und schlussendlich das Thema Bildungsparadox, das ein gefährliches Wettrennen bedeute: Wir haben unendliche Entwicklungsmöglichkeiten, weshalb wir alles tun, damit wir nicht hinter dem Rest zurückbleiben. Obwohl sie die Geschichte nur eines Staates darstellt, zeigt die Ausstellung etwas Universelles, nämlich den Übergang vom Sklaven zum Mitarbeiter.
Vom der Gleichgültigkeit des Mittelalters zur gegenwärtigen Fürsorge
Der Rundgang beginnt mit der in Stände geteilten mittelalterlichen Gesellschaft. Damals wurden Kranke, Alte und Witwen in keiner Weise vom Staat unterstützt und konnten lediglich überleben, weil sie bettelten. Anders verhielt sich die Kirche. Martin Luther brachte mit dem „gemeinsamen Kasten“ die Reichen dazu, sich um die Ärmsten zu kümmern.
Dann geht es weiter durch die Epoche der Industrialisierung vom 19. zum 20. Jahrhundert. Um überleben zu können, musste die ganze Familie arbeiten. Die Älteren bis zu 16 Stunden täglich, die jüngeren im Alter von 9-14 Jahre „nur“ 12 Stunden. Leistungen im Falle von Krankheit, Invalidität und Unfällen sowie Renten für Arbeiter wurden erst im Jahr 1911 mit der Reichsversicherungsordnung eingeführt.
Zum Schluss des Rundganges werden die Grausamkeiten thematisiert, die die Weltkriege mit sich brachten, und auch die Wiedergutmachungsversuche. Zuerst wurde die militärische Mobilisierung über das Wohl der Gesellschaft gestellt, dann wandte sich der Staat von den Kriegsinvaliden und Veteranen ab, die auf den Arbeitsmarkt zurückkehren wollten. Nach den Kriegen aber kam es zu einem Wirtschaftsaufschwung und die Gesellschaft wurde für die ihr zugefügten Leiden mit einer Anhebung der Sozialleistungen entschädigt. Dies war auch ein schlauer Schachzug, um sich Wählerstimmen zu sichern. Im Jahr 1982 betragen die Sozialleistungen bereits 33 Prozent des Bruttosozialproduktes der Bundesrepublik Deutschland, deshalb führt die neue, liberal-konservative Regierungskoalition Veränderungen unter dem Motto „mehr Markt, weniger Staat“ durch.
Die ewige Sozialdebatte
Die Ausstellung „In die Zukunft gedacht“ ist phantastisch nicht nur wegen der Beschreibung eines ungewöhnlichen sozialen Weges, den Deutschland gegangen ist, sondern auch aus visuellen Gründen. In Erinnerung bleiben Holzschnitte und Fotos, von den niederdrückenden Bildern, die Kinder darstellen, die auf Märkten aufgrund ihrer kleinen Hände zur Textilarbeit ausgewählt werden, über Karikaturen von seelenlosen Arbeitern, die nach Herzenslust ausgebeutet werden können, bis hin zu optimistischen Bildern, wie zum Beispiel die Darstellung des millionsten Gastarbeiters, der 1964 als Willkommensgeschenk ein Moped erhielt.
Die Debatte zu Sozialrechten hat kein Ende. Einst kämpften Arbeiter darum, dass ihre Kinder nicht 12 Stunden täglich, sechs Tage die Woche arbeiten mussten, und sie selbst versichert sind. Heute wird darüber diskutiert, wie älteren und behinderten Menschen auf dem Arbeitsmarkt mehr Aktivität ermöglicht werden kann. Die Ausstellung macht dem Besucher bewusst, dass es immer jemanden gibt, für dessen Rechte gekämpft werden muss.
Mariusz Bartodziej